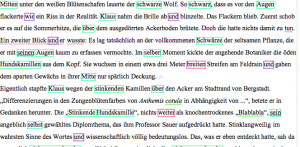Detailfoto aus dem glamourösen Schriftstellerleben. Der Prosecco und der Redakteur der Lokalzeitung, der mich zweimal täglich interviewt, haben nicht mehr aufs Foto gepasst.
Manchmal sitze ich vor meinem Laptop, starre auf die Anzahl der geschriebenen Wörter und frage mich, was ich hier überhaupt mache. Warum habe ich schon wieder 75.000 Wörter für ein Projekt getippt, wenn ich nicht mal weiß, ob ich den Vorgänger veröffentlichungsreif hinbekomme?
Das Unterbewusstsein nuschelt dann: „Nicht fragen. Weitermachen!“ Und die Finger fliegen über die Tasten und tippen wie in Trance Sätze, die während der vergangenen Stunden in meinem Kopf gewachsen sind. Dennoch rumort es im Hinterhalt der abwegigen Gedankengänge.
Böse Zungen zischeln – eingefangen bei Stippvisiten auf Blogs, in Communitys oder Onlineausgaben von Zeitungen: Selfpublisher veröffentlichen ja nur deshalb auf eigene Kappe, weil Verlage sie und ihre Machwerke abgeschmettert haben. Sie sind Möchtegern-Schriftsteller, die dem naiven Traum vom glamourösen Autorenleben hinterherhecheln. Ihre Bücher sind gespickt mit Rechtschreibfehlern und Belanglosigkeiten. Kein Wunder, verschachern sie doch ihr Geschreibsel auf Verkaufsplattformen, ohne dass es jemals ein Korrektor gesehen hat, geschweige denn, dass es vorher ein Lektor auseinanderpflücken konnte.
Gleichzeitig erlebe ich, dass Musiker*), die auf der Independent-Schiene fahren, von anderen für ihre Unabhängigkeit bewundert werden. Schließlich ist genau damit die größtmögliche künstlerische Freiheit verbunden. Selbst Straßenmusiker bekommen im Normalfall ein freundliches Lächeln und ein paar Münzen in den Hut, auch wenn sie es nicht geschafft haben, eines der großen Major-Labels für sich zu begeistern.
Da ich nicht weiß, was andere Menschen dazu antreibt, zu schreiben und zu veröffentlichen, kann ich nur von mir selbst als Independent-Autorin ausgehen. Ich schreibe, weil es mir Spaß macht und weil ich immer besser werde, je mehr und je regelmäßiger ich schreibe. Ob sich ein Verlag für meine Texte interessiert, ist mir Wurst. Was sich ganz gut trifft, denn ich interessiere mich ja auch nicht für Verlage.
Dank meines seit zwei Jahren treuen E-Readers konnte ich schon das eine oder andere selbst veröffentlichte Bücherschätzchen heben. Leider gab es auch Bücher, die ich genervt abbrechen musste. In solchen Fällen hatten mich blendende Kritiken im Webshop oder auf Bücherblogs regelrecht verblendet. Unter den in letzter Zeit drei abgebrochenen E-Books waren übrigens zwei Verlagsbücher. Eines davon erschien in einem recht großen Verlag.
Die zischelnden Stimmen aus dem Hintergrundrauschen des Internets stelle ich mir inzwischen als Äquivalent zur Dorftratsche vor, die über alles und jeden was Schlechtes zu berichten weiß. Vor allem, wenn sie sich mit etwas Neuem und noch nie da Gewesenem konfrontiert sieht. In manchen Fällen stimmt der Tratsch, in anderen nicht.
Übrigens habe ich neulich einen befreundeten Vielleser dabei erwischt, wie er einen mit Kritikerlob überschütteten Weltbestseller nach knapp hundert Seiten in die dunkelste Ecke des Bücherregals stopfte und sich mit leuchtenden Augen in den Text einer Indie-Autorin vertiefte. Er gehört zu den Lesern, die preisgekrönte Literatur bevorzugen und sich ihre Buchempfehlungen aus den Feuilletons holen. Ein weiteres Indiz für mich, dass es im Indie-Meer tatsächlich Bücherperlen zu entdecken gibt.
*****
PS: Zu dem Text hat mich unter anderem eine Aktion der Bloggerin „Bücherdiebin“ inspiriert, die zu dem Thema einige Indie-Autoren befragt hatte. Vielleicht gibt es demnächst dazu hier noch mehr zu lesen.
*) Dass viele (Indie-)Musiker für ihre Arbeit kaum noch Geld bekommen, da die ständige Verfügbarkeit kostenloser Musik diese scheinbar zur Beliebigkeit von Vogelgezwitscher degradiert hat – dank illegaler Downloadplattformen, zweifelhafter Streamingdienste und vielleicht auch eines gesellschaftlichen Wandels, was die Wertschätzung von künstlerischen und kulturellen Leistungen betrifft – ist noch einmal eine ganz andere Geschichte.